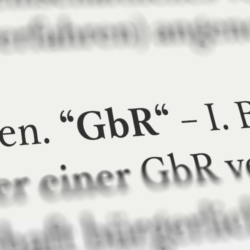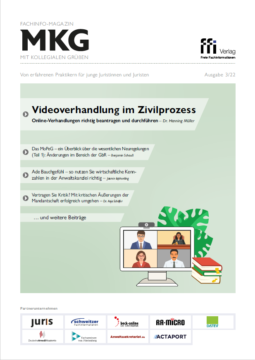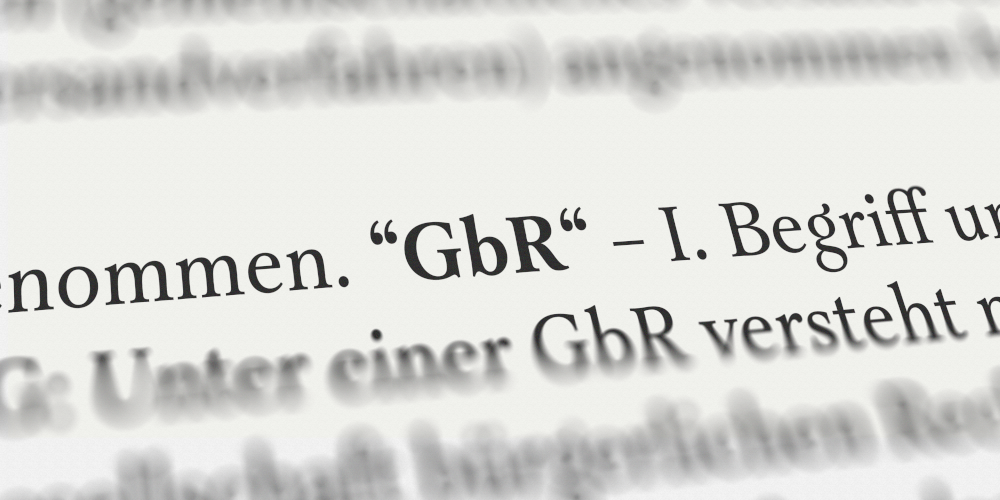
Am 17.8.2021 ist das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) im Bundesgesetzblatt verkündet worden und hat damit eine jahrelange Debatte über die größte Reform des Personengesellschaftsrechts seit über 100 Jahren zu Ende gebracht. Das Gesetz soll ab dem 1.1.2024 in Kraft treten und sieht neben den wohl wichtigsten Änderungen im Bereich der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) – die in diesem ersten Teil der Artikelserie dargestellt werden – auch Änderungen für Personenhandelsgesellschaften, die stille Gesellschaft und Vereine vor, die in einem zweiten Teil behandelt werden.
1. Rechtsfähigkeit der GbR
Nachdem die Rechtsfähigkeit der GbR in der Rechtsprechung und Literatur bereits anerkannt war, findet diese nun auch Einzug in das Gesetz. Das BGB unterscheidet in Zukunft zwischen einer rechtsfähigen und nicht-rechtsfähigen GbR. Nach § 705 Abs. 2 BGB n. F. kann eine GbR als solche „selber Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, wenn sie nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll“. Nach § 705 Abs. 3 BGB n. F. wird bei der unternehmenstragenden GbR das Vorliegen einer rechtsfähigen GbR vermutet, so dass die Rechtsfähigkeit den Regelfall bilden soll.
2. GbR als Rechtsträgerin ihres Vermögens
Die Konsequenz aus der Rechtsfähigkeit der GbR ist die Beseitigung des gesamthänderischen Vermögens durch Streichung der §§ 718-720 BGB. Die GbR ist Rechtsträger ihres eigenen Vermögens, sodass die Zwangsvollstreckung aus einem Titel gegen die Gesellschaft auch nur noch in ihr Vermögen stattfindet. Dadurch ändert sich keineswegs ihre Stellung als Personengesellschaft nach § 14 Abs. 2 BGB; die GbR wird nicht zur juristischen Person. Die GbR kann daher z. B. keine eigenen Anteile erwerben (§ 711 Abs. 1 S. 2 BGB n. F.) und keine „Einpersonengesellschaft“ sein.
3. Gesellschaftsregister der GbR
Eine wesentliche Neuerung durch das MoPeG ist die Einführung eines bei den Amtsgerichten geführten Gesellschaftsregisters, welches dem Handelsregister ähneln wird. Eintragungen wie Gesellschafterbestand und Vertretung der Gesellschaft entfalten im Rechtsverkehr Gutglaubensschutz (§ 707a Abs. 3 BGB n. F.).
Eine Eintragungspflicht besteht zwar nicht, jedoch ist die Eintragung im Gesellschaftsregister Voraussetzung für die Eintragung in bestimmten anderen öffentlichen Registern. Sie gilt zum Beispiel bei der Eintragung der GbR ins Grundbuch (§ 47 Abs. 2 GBO n. F.) oder ins Schiffsregister (§ 51 Abs. 2 SchRegO n. F.). Obligatorisch ist die Eintragung ferner bei der Eintragung ins Aktienregister (§ 67 Abs. 1 S. 3 AktG n. F.) sowie bei der Beteiligung an einer GmbH (§ 40 Abs. 1 S. 3 GmbHG n. F.). Die GbR wird nach erfolgter Eintragung als sog. eGbR geführt. Änderungen im Bestand der Gesellschafterstruktur müssen daher nicht mehr in den einzelnen Registern korrigiert werden.
4. Umwandlungsrecht der GbR
Die eGbR wird zudem ein umwandlungsfähiger Rechtsträger im Sinne des Umwandlungsgesetzes (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 UmwG n.F.). Danach kann die GbR formgewechselt werden (z. B. zur GmbH), aber auch gespalten oder verschmolzen werden.
5. Beteiligungsverhältnisse
Auch die Stimmkraft sowie die Gewinn- und Verlustverteilung nach Kopfteilen wird durch die ohnehin in der gesellschaftsrechtlichen Gestaltungspraxis vorherrschende Verteilung nach den Beteiligungsverhältnissen ersetzt (§ 709 Abs. 3 BGB n. F.). Zudem wird die ebenfalls in der Vertragspraxis gängige Regelung, wonach der Tod oder die Insolvenz eines Gesellschafters entgegen den gesetzlichen Regelungen nicht zur Auflösung der Gesellschaft führen soll, ins Gesetz aufgenommen (§ 723 BGB n. F.).
6. Geschäftsführung und Vertretung
Im Hinblick auf die Geschäftsführung und Vertretung bei der GbR verbleibt es bei dem Grundsatz, dass die Geschäftsführer nur gemeinsam zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. Eine echte Verschärfung im Rahmen der Vertretung der GbR stellt jedoch die Neuerung dar, dass Beschränkungen der Vertretungsmacht gegenüber Dritten in Zukunft unwirksam sind (§ 720 Abs. 3 BGB n. F.).
7. Nachhaftung
Hinsichtlich der Nachhaftung gilt auch weiterhin, dass ein ausgeschiedener Gesellschafter für die Dauer von fünf Jahren nach § 736 Abs. 2 BGB i. V. m. § 160 HGB für die Verbindlichkeiten der GbR forthaftet. Ausgenommen davon werden in Zukunft jedoch Schadensersatzforderungen, wenn die Pflichtverletzung erst nach dem Ausscheiden des Gesellschafters eingetreten ist (§ 728b Abs. 1 S. 2 BGB n. F.).
8. Weitere Änderungen infolge des MoPeG
Das richterrechtlich entwickelte Institut der actio pro socio, also die Klage im Namen der Gesellschaft, findet in § 715b BGB n. F. Eingang in das Gesetz. Das Gleiche gilt für die bislang aus einer Analogie zu § 744 Abs. 2 BGB begründete Notgeschäftsführungsbefugnis (§ 715a BGB n. F.) sowie den Übergang des Vermögens auf den letzten Gesellschafter im Wege der Rechtsnachfolge, wenn der vorletzte Gesellschafter ausscheidet (§ 712a BGB n. F.).
9. Fazit
Auch wenn das MoPeG in vielen Bereichen nur die aktuelle Gestaltungspraxis in Gesetzesform gießt und echte Neuerungen nur in Einzelfällen vorsieht, darf es dennoch als Vorteil gewertet werden, die Rechtslage nicht mehr etlichen Jahrzenten Rechtsentwicklung des Schrifttums und der Rechtsprechung entnehmen zu müssen. Eine echte Fortentwicklung ist hingegen die Einführung eines Gesellschaftsregisters, welches die Rechtssicherheit in der Praxis im Umgang mit der GbR deutlich erhöht. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn der Gesetzgeber auch Themen im Bereich der Digitalisierung des Gesellschaftsrechts innovativ umgesetzt hätte.
Lesen Sie nächste Woche in Teil 2 mehr über die Änderungen durch das MoPeG für die Personenhandelsgesellschaften OHG und KG sowie im Bereich der Stillen Gesellschaft und im Vereinsrecht.
Benjamin Schauß ist Rechtsanwalt bei der überregionalen Wirtschaftskanzlei Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Im Bereich des Bank- und Finanzrechts berät und vertritt er in erster Linie Banken, Finanz- und Zahlungsverkehrsdienstleister.
Kennen Sie schon unser MkG-Magazin?
Im Magazin finden Sie weitere spannende Beiträge u. a. zur Digitalisierung der Justiz, BRAO-Reform und Berufshaftpflicht.